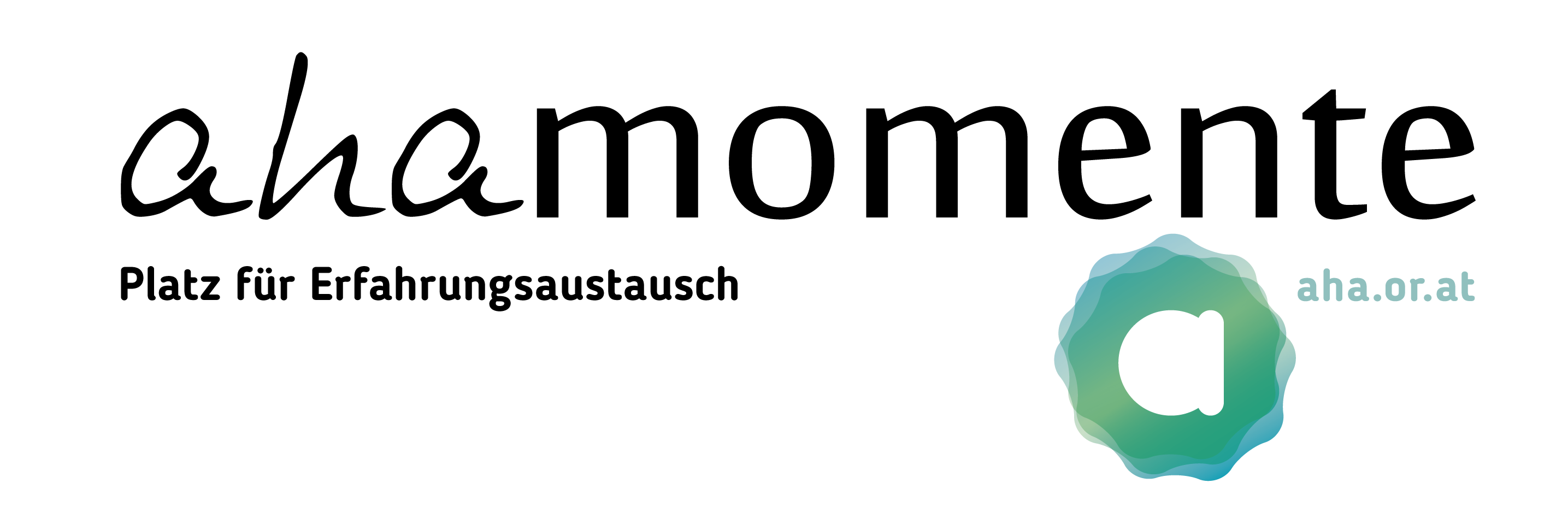Anfang
Als mein letztes Schuljahr anbrach, spürte ich, dass ich bald eine Pause nötig haben würde. Den Großteil meines Lebens hatte ich mit der Nase in Schulbüchern verbracht, immer am selben Ort gelebt, umgeben von denselben Menschen. Ich brauchte einfach mal etwas anderes. Sofort nachdem ich von der Möglichkeit gehört hatte, einen ESK-Freiwilligendienst im Ausland zu machen, wusste ich, dass es das Richtige für mich ist. Von Anfang an war es mir egal, wo ich landen würde, Hauptsache weg. Der Zufall wollte, dass es Spanien wurde. Genauer, Santander an der Nordküste, in der Provinz Kantabrien.
Wenige Monate nach Abschluss meiner Matura war es dann soweit. Ich bin der Typus Mensch, der Zweifel ganz leicht aufschieben kann. Zum Beispiel erinnere ich mich an meine erste Achterbahnfahrt als Kind: Es war die pure Entspannung, bis ich dann in dem Ding saß und die Panik einschlug. So ungefähr war es auch als ich in dieses Flugzeug einstieg. Plötzlich meldeten sich alle meine Ängste, die ich bis dahin ignoriert hatte. Was, wenn ich allein nicht klarkommen würde? Was, wenn ich keine FreundInnen finden würde? Schon immer wollte ich Abenteuer in meinem Leben, aber um ehrlich zu sein, bin ich nicht gerade das, was man sich unter einer Abenteurerin vorstellt: schüchtern, introvertiert, vorsichtig und mit wenig Vertrauen in mich selbst.
Verständlicherweise fühlte ich mich nach meiner Ankunft vollkommen verloren in meiner neuen Umgebung. Aber dieses Gefühl hielt nur wenige Tage an, denn ich erinnerte mich wieder daran, dass ich ja wegen der Herausforderung hergekommen war. Und, dass es normal ist, dass man sich erst einmal an eine große Veränderung gewöhnen muss. Außerdem hatte ein Glückskekszettel mir zugeflüstert, dass ich hartnäckig sein kann.
Freundschaft
Was mir vor allem geholfen hat, mich schnell in meinem neuen Zuhause wohlzufühlen, waren die anderen Freiwilligen. Meine Angst, keine Freundschaften schließen zu können, hatte sich als unbegründet herausgestellt. Wir waren eine große Gruppe von neun Freiwilligen aus verschiedenen Ländern: Österreich, Deutschland, Dänemark, Lettland, Polen, Serbien und Ungarn. Man hatte uns aufgeteilt auf zwei WGs, aber da sich die Wohnungen im selben Gebäude befanden, waren die anderen nie weit entfernt. Wir ergaben zusammen einen bunten und vielseitigen Haufen, da wir charakterlich kaum hätten unterschiedlicher sein können. Trotzdem gab es viel, das uns verband. Wir alle hatten den Drang in uns, die Welt zu sehen und uns weiterzuentwickeln. Eine Freundschaft, wie mit diesen Menschen hatte ich zuvor noch nie erlebt, sie hatte einfach etwas Tiefes und Besonderes und mir enorm geholfen, charakterlich zu wachsen. Nach einigen Monaten des Zusammenlebens fühlte es sich sogar an als wären wir eine kleine Familie.
Soziale Arbeit
Ich war unglaublich nervös an meinem ersten Arbeitstag. Mein Projekt hatte mich mit seiner Beschreibung sofort angesprochen: blinde Menschen führen, ihnen in ihrem tagtäglichen Leben zur Seite stehen, quasi ihr Augenlicht sein. Aber typisch für mich, fühlte ich mich der Aufgabe plötzlich nicht mehr gewachsen. Vor allem die Kommunikation bereitete mir Sorgen, denn kaum eine/r meiner KlientInnen konnte auch nur ein Wort Englisch. Ich hatte zwar vier Jahre lang Spanisch-Unterricht in der Schule gehabt, aber damals war ich noch der festen Meinung, dass ich Spanisch sowieso nie wieder brauchen würde, somit war kaum was hängen geblieben. Und offensichtlich würde ich mit Gestikulieren auch nicht weit kommen. Eine der wichtigsten Lektionen, die ich während meines Freiwilligendienstes gelernt habe, ist, dass ich mehr in meine Fähigkeiten vertrauen muss. Niemand ist perfekt, jeder macht Fehler und man lernt immer dazu. Poco a poco, sagen die SpanierInnen, was so viel bedeutet wie nach und nach. Genauso bin ich auch in meine Aufgabe reingewachsen. Wir hatten einen kleinen Crash-Kurs, wie man Blinde führen sollte vor Antreten des Dienstes, aber am Ende war Feingespür und Empathie am wichtigsten, um eine gute Blindenführerin zu sein. Nicht alle Menschen sind gleich, manche brauchen mehr Sicherheit, andere weniger. So klammerten sich zum Beispiel manche an mich, während andere sich nur an meiner Schulter festhielten. Manche musste ich vor jedem Bordstein warnen, andere spürten es an der Art, wie ich mich bewegte, wie die Straße aussah und brauchten kaum Beschreibungen. Je mehr Zeit ich mit jedem/r einzelnen Klienten/in verbrachte, desto mehr waren wir aufeinander eingespielt und irgendwann verstanden wir uns gegenseitig ohne viele Worte. Mein Spanisch wurde mit jedem Monat besser, ich brannte darauf, mehr zu lernen, damit ich in der Lage war, bessere Gespräche zu führen. Mit einigen meiner KlientInnen konnte ich mich gut anfreunden, trotz meiner mangelhaften Spanischkenntnisse und obwohl wir verschiedenen Generationen angehörten. Bevor ich abreiste, vergewisserte ich mich, dass die Blinden jemanden haben, der ihnen Briefe vorlesen kann.
Abenteuer
Reisen war ein wichtiger Teil meines Freiwilligendienstes. Ich hatte schon immer den starken Wunsch, so viel wie möglich von der Welt zu sehen, doch erst in Spanien hatte ich so richtig die Gelegenheit dazu. Dabei musste es nicht jedes Mal weit weg sein. Schon allein die Gegend, in der wir lebten, hatte so viel zu bieten. An den Wochenenden erkundeten wir Dörfer und verschiedene Sehenswürdigkeiten von Kantabrien. Mit meiner Organisation ONCE konnte ich an Wanderungen durch die Natur teilnehmen. Die Urlaubstage nutzten wir für die weiten Reisen, die manchmal sogar über die spanischen Grenzen gingen: Ich bin einen Berg in Teneriffa hinuntergeklettert (eher gestolpert), habe am Strand von Málaga die Sonne genossen, habe die Architektur von Gaudi in Barcelona bewundert, bin alle Stufen des Eiffelturms hinaufgestiegen, habe die Hitze in Madrid überlebt, bin die riesige Sanddüne in Arcachon hinuntergerannt und war in der beeindruckenden Kathedrale von Santiago de Compostela. Das größte Abenteuer war wahrscheinlich der Jakobsweg, den ich am Ende meines Freiwilligendienstes mit zwei Freunden machte. Von der portugiesischen Grenze aus pilgerten wir nach Santiago und übernachteten jede Nacht woanders (meistens in Herbergen, einmal in einer Garage). Durch meine Reisen habe ich viel gesehen: von den berühmtesten Städten weltweit bis hin zu kleinen, idyllischen Dörfern mitten im Nirgendwo und zu wilder Natur. Spanien und seine Menschen sind mir sehr ans Herz gewachsen. Es ist etwas ironisch für mich, dass ich mich jetzt so in dieses Land verliebt habe, obwohl ich früher durch den Spanisch-Unterricht in der Schule sogar eine leichte Abneigung gegen alles Spanische entwickelt hatte. Jetzt mag ich sogar die Sprache und spreche sie fließend (más o menos). Wahrscheinlich kenne ich mittlerweile mehr von Spanien als von meinem Heimatland Österreich (was ich in Zukunft gerne ändern würde). Ich bin mir sicher, dass ich irgendwann nach Spanien zurückkehren werde, weil es so vieles gibt, was ich noch nicht gesehen habe und ich dort Menschen habe, die auf mich warten.
Veränderung
Für all diese Erfahrungen werde ich immer dankbar sein. Diese Zeit wurde mir geschenkt für mich allein. Ich konnte die Verpflichtungen und Sorgen von Zuhause für eine Weile ruhen lassen und einfach mein Leben genießen. Zurückkehren war ein bisschen, wie aus einem Traum aufwachen. Ich habe mich sehr auf meine Familie und FreundInnen gefreut, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich würde ein freies Leben hinter mir lassen. Nach ein paar Tagen wurde mir aber klar, dass ich jetzt weiß, was mich glücklich macht und, dass ich dafür nicht zwingend in ein anderes Land gehen muss. Ich kann mich selbst immer wieder herausfordern, nach Abenteuern suchen, mal Abstand gewinnen von meinen Pflichten und meine Zeit mit wunderbaren Menschen verbringen. Es bringt mich zum Schmunzeln, dass ich erst wegmusste, um etwas in mir zu finden. Ich weiß jetzt, was ich will von meinem Leben und ich weiß, dass ich alles schaffen kann.